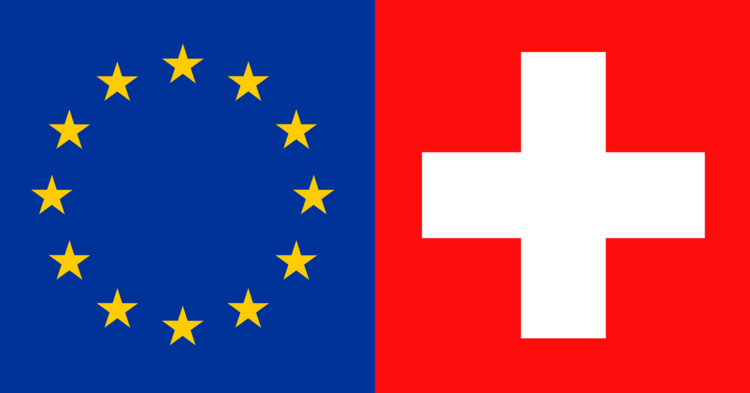Die Schweiz ist wirtschaftlich eng mit der EU verbunden. Die Unternehmen, Hochschulen beider Seiten und letztlich wir alle profitieren vom Zugang zum Markt, von der Forschungszusammenarbeit oder von vereinfachten Reisen. Stabile vertragliche Beziehungen sind deshalb im gegenseitigen Interesse.
Die neuen EU-Verträge sind jedoch mit zentralen Prinzipien unseres Staatsverständnisses nicht vereinbar. Es geht um Grundsätzliches: das Primat des Volksentscheids und eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung.
- Dynamische Rechtsübernahme: Sanktionen bei Volksentscheid
Kern des neuen Vertragswerks ist die «dynamische Rechtsübernahme». Künftig würde Brüssel entscheiden, was in den sektoriellen Abkommen gilt. Neue Regeln der EU würden quasi automatisch übernommen, sofern sie einen Zusammenhang mit einem Vertragsgebiet aufweisen. Das Schweizer Parlament müsste sie unter Zeitdruck durchwinken – bei Ablehnung drohen Sanktionen.
Auch ein demokratischer Volksentscheid gegen eine neue Regel würde mit Sanktionen belegt werden. Denn im Vertrag ist vorgesehen, dass jegliche Abweichungen zu einseitigen Sanktionen der EU führen. Das Schweizer Stimmvolk dürfte also noch abstimmen, aber nur unter der Drohung von Sanktionen. Das entwertet unsere direkte Demokratie nachhaltig. - Geringer wirtschaftlicher Nutzen
Der Bundesrat begründet das Vertragswerk mit wirtschaftlichen Argumenten. Doch selbst wenn – was kaum realistisch ist – alle bisherigen bilateralen Verträge aufgehoben würden, zeigen die Zahlen ein anderes Bild: Eine vom Bund in Auftrag gegebene Studie kommt zum Schluss, dass das Bruttoinlandprodukt pro Kopf über 20 Jahre kumuliert um nur 1,65 Prozent weniger wachsen würde. Das entspricht etwa 0,08 Prozent pro Jahr – weniger als einem Promille. Für diesen minimalen Effekt sollten wir unsere politische Eigenständigkeit nicht so stark einschränken. - Migration: Die Realität übertrifft alle Prognosen
Ein besonders sensibler Punkt ist die Zuwanderung – u. a. mit negativen Folgen für den Wohnungsmarkt. Die Erfahrung mit der Personenfreizügigkeit zeigt: Die Prognosen lagen massiv ndaneben. Im Abstimmungskampf zur Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2000 prognostizierte der Bundesrat netto maximal 10 000 Zuwanderer pro Jahr aus der EU. Tatsächlich kamen in den folgenden rund 20 Jahren im Schnitt über 40 000 Personen pro Jahr – 2024 sogar über 50 000. Statt der prognostizierten 200 000 Personen wanderten nahezu ein Million Personen ein. Die neue Unionsbürgerrichtlinie, die im Rahmen der Verträge übernommen werden soll, würde diesen Trend verstärken: Mit dem erleichterten Familiennachzug könnten Nichterwerbstätige sogar aus Drittstaaten einfach in die Schweiz einreisen, Daueraufenthalt erhalten und eine Ausweisung wäre kaum mehr möglich. Die ausgehandelte Schutzklausel ist eine Fehlkonstruktion und wird kaum je Anwendung finden – ein Papiertiger. - Kohäsionsbeitrag ohne eigenständig bestimmbare Zweckbindung
Die Schweiz soll jährlich 350 Millionen Franken Kohäsionsbeitrag leisten – ohne eigenständig bestimmen zu können, wohin das Geld geht. Mit einem Bruchteil dieser gewaltigen Summe von 3,5 Milliarden über zehn Jahre könnte man inländische KMU gezielt unterstützen, um den administrativen Aufwand im EU-Handel zu bewältigen.
Nein nach sorgfältiger Güterabwägung
Ja, die Schweiz will stabile Beziehungen zur EU – aber nicht um jeden Preis. Die neuen Verträge schränken unsere Souveränität zu stark ein. Sie schaffen unumkehrbar eine passive EU-Teilmitgliedschaft und bringen keine substanziellen wirtschaftlichen Vorteile. Statt dynamischer Rechtsübernahme braucht es Verhandlungen auf Augenhöhe. Statt institutioneller Anbindung brauchen wir funktionierende sektorielle Abkommen, wie sie heute bestehen. Das ist kein Nein zur EU, sondern ein JA zur direktdemokratischen Schweiz.